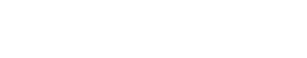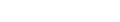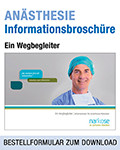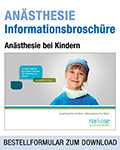42. Jahrgang - Dezember 2001
Anästhesie während der Schwangerschaft (CME 9/01)
Anaesthesia in pregnancy
Zusammenfassung: Neben geburtshilflichen Operationen wie einer Cerclage und fetalen Eingriffen wird bei ca. 2% aller Schwangeren während der Schwangerschaft eine nichtgynäkologische Operation durchgeführt. Hierbei müssen die physiologischen Veränderungen während der Gravidität ebenso berücksichtigt werden, wie die potentiellen teratogenen Schäden und Nebenwirkungen beim Neugeborenen.
Da bei fast allen in der Anästhesie eingesetzten Substanzen eine teratogene Wirkung nicht bekannt ist, hat die Auswahl des Anästhesieverfahrens weniger Bedeutung als die Aufrechterhaltung des mütterlichen arteriellen Drucks, der Oxygenierung und einer Normokapnie. Bei fetalen Operationen ist eine Allgemeinanästhesie aufgrund der über die Plazenta erfolgenden Anästhesie und Immobilisation des Fetus im Vergleich mit einer Regionalanästhesie vorzuziehen. Als zusätzliche Überwachungsmaßnahmen sollten eine kontinuierliche Messung der fetalen Herzfrequenz, eine Kontrolle der Wehentätigkeit sowie bei fetalen Operationen die Messung des zentralen Venendrucks erfolgen. Letzteres erfolgt aufgrund des erhöhten Risikos eines Lungenödems bei gleichzeitiger Tokolyse. Für den intraoperativen Einsatz von Tokolytika eignen sich neben den Inhalationsanästhetika am ehesten Magnesium und Nitroglycerin, aber auch ß-Sympathomimetika und Kalziumantagonisten. Beim Einsatz von Vasopressoren zur Aufrechterhaltung des arteriellen Drucks ist nicht so sehr die Wahl des Medikamentes, als vielmehr die vorsichtige Titration mit Vermeiden einer überschießenden Hypertonie entscheidend, da jede Substanz dosisabhängig den uterinen Blutfluß beeinträchtigen kann. Postoperativ sollte eine möglichst gute Analgesie mit Vermeiden einer Streßreaktion bei gleichzeitig fortgesetzter fetaler Überwachung durchgeführt werden. Auch wenn es durch die Gabe von Analgetika oder Anästhetika zu einer eingeschränkten fetalen Herzfrequenz kommt, können späte Dezelerationen und fetale Bradykardien erkannt und behandelt werden.